Lust auf ein persönliches Gespräch mit mir?
Ab sofort ist auf der Webseite „Buch-den-Uhrle“ freigeschalten, bei welchem man Termine mit mir Buchen kann.
Diese können virtuell, persönlich oder bei einer Runde auf dem Trimm-dich-Pfad statt finden.

Lust auf ein persönliches Gespräch mit mir?
Ab sofort ist auf der Webseite „Buch-den-Uhrle“ freigeschalten, bei welchem man Termine mit mir Buchen kann.
Diese können virtuell, persönlich oder bei einer Runde auf dem Trimm-dich-Pfad statt finden.
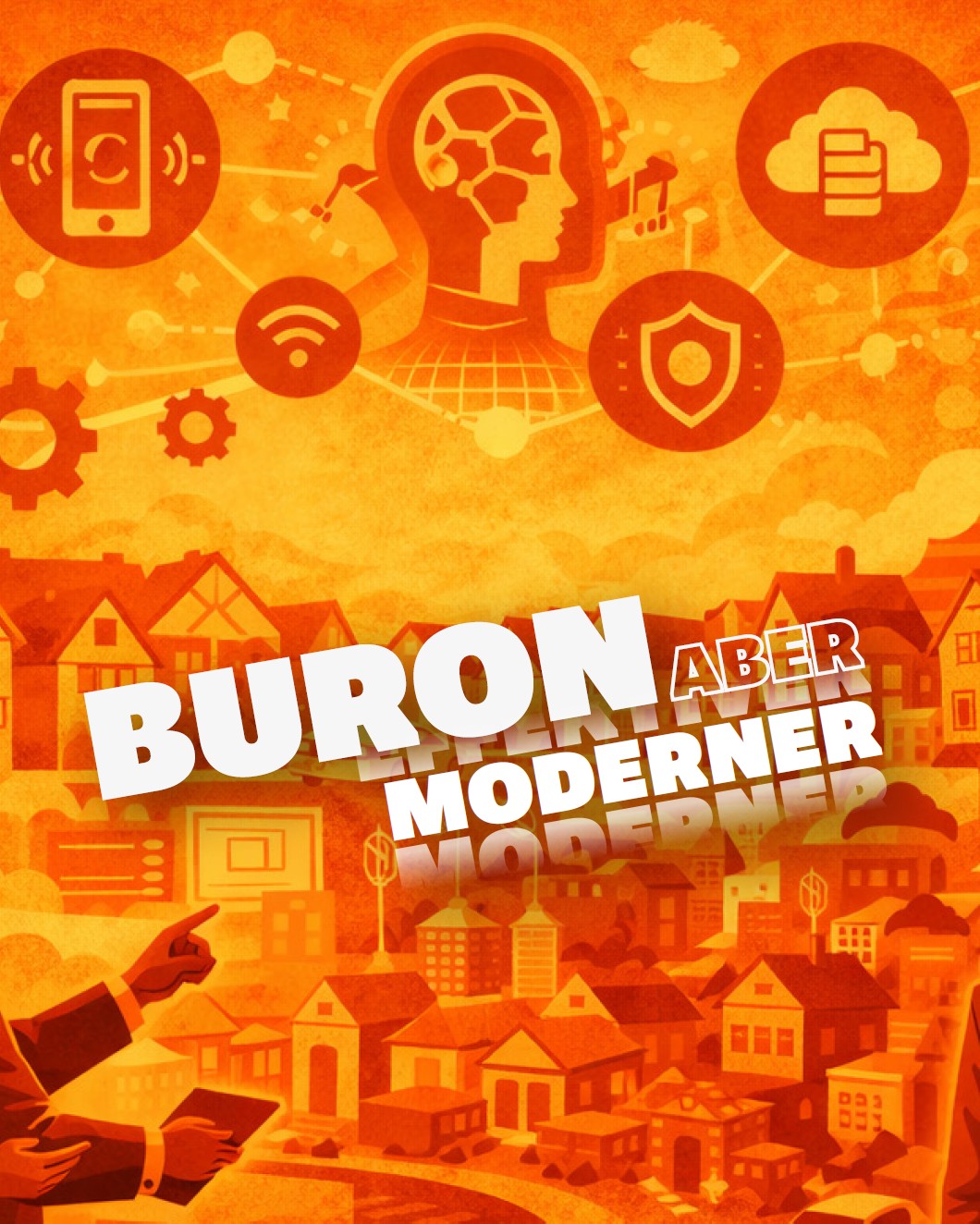
Mit unserem neuen Wahlprogramm für die Jahre 2026 bis 2040 beschreiten wir als Kaufbeurer Initiative gemeinsam mit unserem Oberbürgermeisterkandidaten Alexander Uhrle und unserer Stadtrats-„Macher-Liste“ bewusst neue Wege. Statt kurzfristiger Versprechungen oder kostspieliger Wunschkataloge setzen wir auf ein strukturiertes, realistisch umsetzbares und wirtschaftlich verantwortbares Zukunftskonzept für Kaufbeuren.
„Wir wollten kein Wahlprogramm schreiben, das auf dem Papier gut klingt, aber an Haushaltsrealitäten und Verwaltungsabläufen scheitert. Unser Ansatz ist klar: Erst stabilisieren, dann modernisieren – und darauf aufbauend gezielt innovieren.“
Kern unseres Programms ist eine klare zeitliche Gliederung in drei Phasen. In der ersten Phase (2026–2030) liegt unser Fokus bewusst auf Verwaltungskonsolidierung, Effizienzsteigerung und strukturellem Aufbau. Angesichts der angespannten kommunalen Haushaltslage setzen wir hier auf Maßnahmen, die finanzierbar, förderfähig und organisatorisch realistisch umsetzbar sind.
Darauf aufbauend folgen die Phasen 2 (2031–2035) und 3 (2036–2040), in denen wir größere Entwicklungsschritte – etwa in den Bereichen Innovationsnetzwerke, Energie- und Wärmekonzepte oder Smart-City-Anwendungen – gezielt und planbar umsetzen wollen. „Innovation braucht ein solides Fundament. Genau das legen wir in den ersten Jahren.“
Ein zentrales Element unseres Wahlprogramms ist die konsequente Stärkung von Bürgerbeteiligung und Transparenz. Wir wollen politische Entscheidungen nachvollziehbarer machen und die Menschen deutlich stärker in die Entwicklung ihrer Stadt einbinden.
Konkret setzen wir unter anderem auf Bürgergenossenschaften, über die sich Bürgerinnen, Bürger und lokale Unternehmen direkt finanziell und inhaltlich an Projekten in Kaufbeuren beteiligen können. Ergänzt wird dies durch eine digitale Beteiligungsplattform, die es ermöglicht, Meinungen, Ideen und Rückmeldungen unkompliziert einzubringen – transparent und mit klarer Rückmeldung, was aus den Beiträgen wird.
Darüber hinaus setzen wir auf Open-Data-Ansätze, ein öffentlich einsehbares Smart-City-Dashboard sowie klar strukturierte Entscheidungsprozesse. Unser Ziel ist es, Verwaltungshandeln messbar zu machen, Vertrauen zu stärken und politische Entscheidungen besser erklärbar und überprüfbar zu gestalten.
„Bürgerbeteiligung darf kein Schlagwort sein. Wir wollen Formate schaffen, die echte Mitgestaltung ermöglichen – und gleichzeitig offenlegen, warum Entscheidungen so getroffen werden, wie sie getroffen werden.“
Inhaltlich orientiert sich unser Wahlprogramm an sechs klar definierten Handlungsfeldern: Wirtschaft, Bevölkerung, Verwaltung, Mobilität, Umwelt und Lebensqualität. Diese Struktur sorgt nicht nur für Übersichtlichkeit, sondern macht Fortschritte überprüfbar und steuerbar. Viele Maßnahmen sind bewusst modular angelegt, sodass sie schrittweise umgesetzt oder an die jeweilige wirtschaftliche Lage angepasst werden können.
Mit unserem Programm positionieren wir uns klar gegen eine Politik der Maximalforderungen. Stattdessen verstehen wir Stadtpolitik als Handwerk: gut vorbereitet, finanziell durchdacht und gemeinsam mit Bürgerschaft, Wirtschaft und Vereinen umgesetzt.
„Wir machen keine Politik für Schlagzeilen, sondern für die nächsten zehn bis fünfzehn Jahre. Unser Wahlprogramm ist kein Wunschzettel, sondern ein Arbeitsplan, der sich an einer klassischen Geschäftsstrategie orientiert.“
Das detaillierte und vollständige Wahlprogramm ist ab sofort online unter Buron.de einsehbar und zum Download verfügbar. Eine verkürzte, kompakte Version befindet sich aktuell in der Ausarbeitung.

Nach ein paar Monaten „Auszeit“ wurde es wieder Zeit für einen Kolumnenbeitrag auf Wir sind Kaufbeuren. Diesmal ein Thema, welches (mir) sehr wichtig ist, aber auch schwer zu erklären. Ich versuchte mein Bestes…
Was würde eine echte Transformation für Kaufbeuren bedeuten?
Ganz konkret: schnellere und verständlichere Verwaltungsprozesse, modernere digitale Angebote, weniger Bürokratie und klarere Zuständigkeiten. Für die Wirtschaft heißt es: mehr Planungssicherheit, bessere Daten, effizientere Genehmigungen und ein Standort, der mit den Herausforderungen der Zukunft mithalten kann. Kurz: eine Stadt, die besser funktioniert – für alle.
Wer „Transformation“ hört, denkt oft an große Maschinen, die sich in Sekunden in riesige Roboter verwandeln. Die Älteren kennen das noch aus der Trickfilmserie der 80er, die Jüngeren aus Hollywood-Filmen voller Explosionen und metallischem Scheppern.
Doch genau hier beginnt das Missverständnis.
Transformation in der echten Welt funktioniert ganz anders:
Sie ist leiser, anstrengender und weniger spektakulär – aber dafür viel wirkungsvoller.
Transformers verwandeln sich, weil es cool aussieht.
Organisationen, Städte und Unternehmen verwandeln sich, weil sie es müssen, um zukunftsfähig zu bleiben.
Vom Kugellager zum Motion-Technology-Unternehmen
Ein Beispiel aus der realen Welt: mein Arbeitgeber Schaeffler, für den ich in der Strategischen Digitalisierung arbeite.
Lange galt Schaeffler als klassischer Autozulieferer – technisch stark, aber ein Teil eines großen Systems.
Heute verfolgt das Unternehmen ein neues Selbstverständnis: The Motion Technology Company.
Das klingt nach Marketing – ist aber handfeste Strategie.
Während viele Firmen in der aktuellen Automobilkrise kämpfen, legt Schaeffler beim Aktienkurs plötzlich 60 % in einem Jahr zu. Nicht wegen eines neuen Logos, sondern wegen echter Veränderung:
Architektur heißt hier:
Wie Prozesse, Fähigkeiten, Daten, Systeme und Ziele so aufeinander abgestimmt werden, dass die Organisation als Ganzes funktioniert – nicht als Stückwerk.
Transformation heißt also nicht nur die Form zu wechseln.
Transformation heißt, innen wie außen neu zu denken.
Und sie ist kein Projekt – sondern eine Fähigkeit.
Und Kaufbeuren? Wo steckt unser innerer „Optimus Buron“?
Transformation klingt groß und mächtig – fast zu monumental für eine Stadt wie Kaufbeuren.
Aber genau hier wird es spannend:
Kommunale Transformation muss nicht laut sein. Sie muss verständlich sein.
Denn eine Stadt ähnelt in vieler Hinsicht einer Organisation im Wandel:
Um diesen Wandel zu steuern, gibt es Werkzeuge wie Enterprise Architecture Management (kurz EAM).
Das klingt kompliziert, bedeutet aber etwas Einfaches:
EAM hilft, eine Organisation (z. B. Unternehmen oder Kommune) als Gesamtsystem zu verstehen – also Prozesse, Daten, Fähigkeiten, IT, Organisation und Ziele miteinander abzustimmen.
Und TOGAF?
Das ist ein international anerkanntes Rahmenwerk, ein „Bauplan“, der beschreibt, wie man:
Kurz: Es hilft, planvoll statt zufällig zu modernisieren.
Warum beginnt echte Transformation bei Daten?
Viele erwarten, dass Transformation mit Bauprojekten, Umstrukturierungen oder digitalen Formularen beginnt.
Doch der erste Schritt ist unsichtbar:
Transformation beginnt mit Daten.
Und mit Transparenz.
Eine Stadt braucht ein gemeinsames Verständnis davon:
Das klingt selbstverständlich – ist es aber nicht.
Viele Kommunen springen direkt zum „Lösungen kaufen“, statt erst zu verstehen, was sie eigentlich brauchen.
Ein kommunales EAM würde Kaufbeuren unterstützen:
Kurz: Effizienter und schneller zu arbeiten um u. a. Geld zu sparen und flexibler aufgestellt zu sein.
Transformation entsteht nicht durch hektisches Handeln – sondern durch strukturiertes Verstehen und gemeinsames Ausrichten.
Was müsste Kaufbeuren tun?
Keine Revolution.
Keine Laserkanonen.
Keine Roboter, die sich in Ampelmasten verwandeln.
Sondern:
Wenn Verwaltung, Politik und Stadtgesellschaft ein gemeinsames Bild vom „Ziel-Kaufbeuren“ haben, entsteht Transformation fast automatisch. Nicht laut, aber nachhaltig.
Fazit: Transformation ist weniger Hollywood – mehr Handwerk
Während Transformers ihre Form wechseln, um Endgegner zu besiegen, verändern Städte sich, um ihre Zukunft zu sichern.
Oft sieht das nach außen unspektakulär aus – doch innerlich bedeutet es:
Transformation ist kein Spektakel.
Transformation ist eine Fähigkeit.
Und vielleicht ist das die größte Gemeinsamkeit zwischen Optimus Prime und einer Kommune:
Beide müssen zuerst verstehen, wer sie sein wollen – bevor sie sich verwandeln können.

Als 1. Vorsitzender der Kaufbeurer Initiative freue ich mich, dass wir nun unsere Kandidatenliste für die Kommunalwahl 2026 finalisiert haben. Besonders stolz bin ich darauf, dass sich auf unserer Liste 15 Geschäftsführer oder Selbstständige sowie Kandidatinnen und Kandidaten mit insgesamt 26 Vorstandsämtern befinden. Für mich ist dies eine wahre „Macher-Liste“, die genau die richtige Einstellung mitbringt, um Kaufbeuren positiv zu verändern.
Mit einem Altersdurchschnitt von 44,4 Jahren spiegelt unsere Liste eine ausgewogene Mischung aus wertvoller Erfahrung und frischen Perspektiven wider. Zudem ist unsere enge Verbundenheit zum gemeinnützigen Verein Hockey for Hope, der aus der Kaufbeurer Initiative entstanden ist, weiterhin deutlich sichtbar – 15 aktive Mitglieder und Vorstände von Hockey for Hope kandidieren für uns.
Unsere Liste steht auch für einen Neustart der Kaufbeurer Initiative. Der im Vereinsvorstand 2022 vollzogene Generationenwechsel zeigt sich nun auch im Rahmen der Kommunalwahl wirkungsvoll. Begleitet von einem Re-Branding, also der kompletten Neugestaltung unseres öffentlichen Auftritts, wird der Generationenwechsel auch visuell erlebbar.
Die außertourliche Aufstellungsversammlung fand diesmal an einem Freitag statt – sonst sind unsere Vereinstermine mittwochs – und die Wahl unserer 40 Kandidatinnen, Kandidaten und Ersatzleute erfolgte in einer geheimen Blockwahl. Mit über 94 % Zustimmung der Wahlberechtigten für unseren Vorschlag habe ich eine große Geschlossenheit gespürt. Die Versammlung im Gasthaus Belfort, dessen Betreiber Matko Cuturic selbst auch kandidiert, wurde dabei von unserem 2. Vorsitzenden Stephan Kopetzky und Stadtrat a. D. Ernst Holy geleitet.
Mir ist besonders wichtig hervorzuheben, dass die Kaufbeurer Initiative einen überparteilichen Charakter bewahrt. Neben der GenerationKF sind wir die einzige Kandidatenliste, die ohne parteipolitische Bindung ausschließlich das Wohl unserer Stadt in den Mittelpunkt stellt. Unser Leitmotiv „Das Beste für die Stadt“ hat für mich nach wie vor uneingeschränkte Gültigkeit.
Für den Wahlkampf 2026 haben wir ein neues, prägnantes Motto gewählt: „Buron, aber …“. Dieser Slogan greift die besondere Identität unserer Stadt auf und gibt den Kandidatinnen und Kandidaten Raum, ihre individuellen Themen einzubringen.
Mit der breiten beruflichen und gesellschaftlichen Verankerung unserer Kandidaten und der überragenden Zustimmung sehe ich die Kaufbeurer Initiative bestens aufgestellt für die kommenden Herausforderungen.
Erste Einblicke in unser Wahlprogramm konnten wir bereits bei der Versammlung geben – die vollständige Vorstellung folgt, sobald das Programm fertiggestellt ist. Auch hier wollen wir frische Akzente setzen.
Den Abend rundete die Planung für die Lebende Krippe ab, die am 20. und 21. Dezember stattfinden wird und erneut Gelder für Bedürftige aus Stadt und Land sammelt.
Ich freue mich darauf, diesen spannenden Weg gemeinsam mit unserem engagierten Team weiterzugehen.

Letzte Woche hatte ich die Gelegenheit, im Rahmen meiner Tätigkeit für Schaeffler, an der SAP Transformation Excellence Summit in Den Haag teilzunehmen – eine inspirierende Veranstaltung, die sich dem Austausch zu aktuellen Trends und Best Practices rund um Transformationen widmet.
Im Mittelpunkt meines Beitrags stand ein spannendes Enterprise Architecture Projekt, das ich im Rahmen der Summit vorstellte. Die Präsentation beleuchtete den gesamten Prozess: von der initialen Idee über die Gewinnung von Unterstützern bis hin zur erfolgreichen Umsetzung. Besonders wertvoll war dabei die Unterstützung meiner Kollegin, die als Nutznießerin des Projektes aus ihrer Perspektive berichtete und damit die verschiedenen Blickwinkel anschaulich darstellte.
Darüber hinaus hatte ich die Möglichkeit, in einem Roundtable intensiv mit anderen Teilnehmern über das Projekt zu diskutieren. Eine Stunde lang stand ich Rede und Antwort, wodurch tiefere Einblicke sowie ein lebhafter Austausch zu Herausforderungen und Erfolgsfaktoren ermöglicht wurden.
Ein Projekt von mir, wurde als Success Story verkauft, hier stand ich, neben meiner Kollegin die aus „Anwender-Sicht“ berichtete, vor der Kamera Rede und Antwort.

Der Höhepunkt der Summit war der überraschende Gewinn des Awards „Enterprise Architecture Excellence – Fast Time to Value“. Dieser zeichnet den schnellen und nachhaltigen Erfolg des vorgestellten Projektes aus, das ich initiiert und angetrieben habe. Der Award ist in erster Linie das Ergebnis einer sensationellen, abteilungsübergreifenden Teamleistung, bei der wir uns gegen namhafte Mitnominierten wie Carlsberg, Heineken und Heidelberg Materials durchsetzen konnten.

Neben dem direkten Austausch mit weiteren renommierten Unternehmen nutzte ich zudem die Gelegenheit, an einer Weiterbildung im Bereich Prozessmanagement teilzunehmen, um meine Kenntnisse weiter zu vertiefen und zukünftig noch effektiver agieren zu können.

Es ist so weit – zusammen mit einem Freund Pascal Hübner haben wir einen Podcast gestartet: „Die Buronen – Planlos durch das Stadtgeschehen“. Der Name ist Programm: Es gibt kein Skript, keine festgelegten Themen, sondern echte Gespräche mitten aus dem Kaufbeurer Leben – spontan, offen und ungeschnitten.
Was unseren Podcast besonders macht: Wir sitzen nicht im sterilen Studio, sondern sind draußen unterwegs – mitten im Stadtgeschehen, mit allem was dazugehört. Die Menschen, die Geräusche, die Atmosphäre – und: das Ganze auch als Video.
Unsere erste Ausgabe haben wir direkt im Herzen der Stadt aufgenommen – unter dem Fünfknopfturm. Mit dabei:
Ein Gespräch über Ehrenamt, Selbstständigkeit, Sport und alles, was uns spontan in den Sinn kam.
Wir planen, wöchentlich eine neue Folge zu veröffentlichen.
Wir freuen uns sehr über Feedback – oder dass du ggf. selbst dabei sein willst?
Links zu den Streaminganbietern: